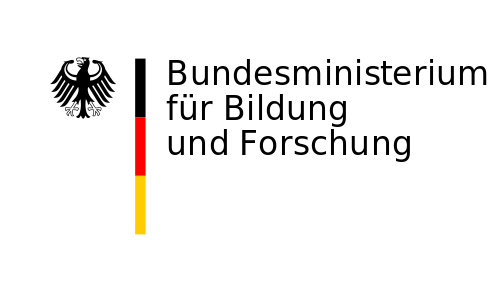1. Outsourcing als Managementaufgabe
Wie Thomas Bieger in seinem Lehr- und Handbuch „Dienstleistungsmanagement: Einführung in Strategien und Prozesse bei persönlichen Dienstleistungen“ schreibt, ist bei der Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen „[b]esonderes Augenmerk […] den Übergängen von einem zum anderen Unternehmen zu schenken, da diese Übergänge, aufgrund unklarer Zuständigkeiten, eigentliche Qualitätslücken bilden können“1)Bieger 2000: 168.. Durch die Einrichtung eines „Schnittstellen-Management[s]“2)Siebecke 1999: 144. können Einrichtungen sich für diese Organisationsaufgabe wappnen. Auch Nils Urbach und Tobias Würz, die sich in ihrer Forschung vornehmlich mit IT-Outsourcing befassen, kommen zu der Schlussfolgerung, dass für ein erfolgreiches Outsourcing-Vorhaben weniger die äußeren Rahmenbedingungen ausschlaggebend sind als vielmehr die gezielte Regulierung der Schnittstelle zwischen den zusammenarbeitenden Unternehmen. Laut Urbach und Würz hängt der Erfolg eines Outsourcing-Projektes „stark vom auslagernden Unternehmen selbst ab sowie von dessen Fähigkeit, eine IT-Outsourcing-Beziehung zu gestalten, aufzubauen und zu steuern. Entsprechend wird die Governance der Geschäftsbeziehung als wichtiger Erfolgsfaktor des IT-Outsourcings angesehen“3)Urbach / Würz 2012b: 35.. Unter den Begriff der hier relevanten „Beziehungscharakteristiken“ fassen die Autoren nicht nur formale Aspekte wie die Vollständigkeit des schriftlichen Vertrags, sondern auch die Wahrnehmung von Servicequalität sowie Vertrauen und Flexibilität.4)Vgl. Urbach / Würz 2012b: 36. Die kontinuierliche Steuerung dieser Beziehungscharakteristiken stellt eine „operative Herausforderung“5)Urbach / Würz 2012b: 36. für die outsourcende Organisation dar.
Um Unternehmen beim Meistern dieser Herausforderung zu unterstützen, haben Urbach und Würz ein Rahmenwerk zur Steuerung von IT-Outsourcing-Vorhaben entwickelt, das verschiedene Steuerungsmechanismen in einem integrierten Ansatz zusammenführt und außerdem kontextabhängige Faktoren berücksichtigt. Zu den identifizierten Steuerungsmechanismen gehören das Vertragsmanagement, das Kommunikationsmanagement, das Risikomanagement, das Performance-Management und die Serviceverbesserung. Das Rahmenwerk lässt sich auf den Hochschulkontext und den Fremdbezug von Dienstleistungen im FDM-Bereich übertragen. Die in diesem Leitfaden genannten Steuerungsmechanismen sind folglich dem Rahmenwerk von Urbach und Würz entnommen.6)Vgl. Urbach / Würz 2012b; Urbach / Würz 2012a. Das Rahmenwerk basiert laut Urbach und Würz auf Erkenntnissen der Forschung im Bereich der IT-Outsourcing-Steuerung und wurde mithilfe von Interviews mit Fachleuten sowie einer praktischen Fallstudie evaluiert und weiterentwickelt. Bevor die Steuerungsmechanismen im Detail dargestellt werden, erfolgt noch ein Blick auf die einzelnen Realisierungsphasen des Outsourcing-Prozesses. Anhand dieses kurzen Überblicks wird deutlich, welche Herausforderungen auf eine outsourcende Forschungseinrichtung in welcher Phase zukommen und an welcher Stelle die einzelnen Steuerungsmechanismen vornehmlich einsetzen.
2. Realisierungsphasen des Outsourcing-Prozesses
Generell lassen sich die aufeinanderfolgenden Phasen eines Outsourcing-Vorhabens grob untergliedern in eine strategische Entscheidungsphase, eine Planungs- bzw. Umsetzungsphase sowie eine Konstituierungs- und Konsolidierungsphase.7)Vgl. Siebecke 1999: 144. Eine differenzierte Unterteilung liefern Peter A. Cunningham und Friedrich Fröschl. Sie gliedern den Outsourcing-Prozess in insgesamt acht Phasen: Initialisierung, Kapazitäts- und Kostenanalyse, Kontaktaufnahme zu Dienstleistungsunternehmen, Angebotsevaluation, Anbieterselektion, Vertragsverhandlung und ‑gestaltung, Implementierung und Management der Anbieterbeziehung.8)Vgl. Cunningham / Fröschl 1995: 135–180. Die einzelnen Realisierungsphasen sollen an dieser Stelle nur grob skizziert werden, da das Hauptaugenmerk dieses Leitfadens auf den Steuerungsmechanismen liegt, die im Rahmen des Outsourcing-Prozesses eine Rolle spielen.
a) Entscheidungsphase
In der Entscheidungsphase trifft eine Einrichtung die Entscheidung für oder gegen den Bezug von Leistungen eines externen Unternehmens. Die Einrichtung sollte für sich definieren, aus welchen strategischen Gründen ein Outsourcing von Diensten angestrebt wird.9)Vgl. Siebecke 1999: 146. Im Falle von Hochschulen oder Forschungseinrichtungen, die eine bestimmte FDM-Servicedienstleistung beziehen wollen, die in der Form an der eigenen Institution bislang nicht angeboten wird, ist die Entscheidung über Outsourcing „eine ‚make-or-buy‘-Entscheidung vom Nullpunkt aus. Da also nicht bestehende ‚make‘-Routinen überwunden werden müssen, stehen dem ‚buy‘ geringe Barrieren entgegen.“10)Ziegele 2001: 10. Dennoch bedürfen die oberflächlich festgestellten Mängel im FDM-Serviceangebot einer genauen internen Kosten- und Kapazitätsanalyse, auf deren Grundlage die Entscheidung zum Fremdbezug einer Leistung getroffen werden kann.11)Vgl. Cunningham / Fröschl 1995: 141–143.
b) Planungs- bzw. Umsetzungsphase
Hat sich eine Forschungseinrichtung für die Durchführung eines Outsourcing-Vorhabens entschieden, geht es in der Planungsphase zunächst darum, einen geeigneten Dienstleistungsanbieter zu finden. Entweder führt die Einrichtung selbst eine Marktanalyse durch oder sie fordert über eine Ausschreibung potenzielle Anbieter auf, ein Angebot zu erstellen. Für beide Verfahren ist es notwendig, zuvor einen Anforderungskatalog zu erstellen, der präzise die Anforderungen beschreibt, die der FDM-Service erfüllen soll und unter welchen Konditionen sie erfüllt werden müssen. An einer Kooperation interessierte Dienstleistungsunternehmen können anhand des Anforderungskatalogs prüfen, inwieweit ihre Dienste passen und ggf. ein Angebot unterbreiten. Ebenso ist der Katalog für die Forschungseinrichtung die Schablone, um den bestmöglichen Dienstleistungserbringer auszuwählen.12)Vgl. Cunningham / Fröschl 1995: 146. Jürgen Gross, Jörg Bordt und Matias Musmacher weisen darauf hin, dass es essenziell sei, bereits im Ausschreibungsverfahren „die Vorgehensweise, Werkzeuge, Maßnahmen zur kontinuierlichen Optimierung, die Form der Kundenzufriedenheitsmessung, das Governance-Modell, die eingesetzten Betriebsprozesse und die Absicherung der Service-Level“13)Gross / Bordt / Musmacher 2006: 177. zu nennen. Alles andere führe zu einem erhöhten Missverständnis-Risiko zwischen Outsourcer und Dienstleistungsunternehmen. Die Auswahlphase ist üblicherweise von zusätzlichen, detaillierten Gesprächen begleitet.14)Vgl. Wißkirchen 1999: 176; Cunningham / Fröschl 1995: 147. In dieser Phase kommt nicht nur dem Anforderungsmanagement, sondern auch dem Risikomanagement eine besondere Rolle zu. Zentrale Selektionskriterien bei der Anbieterauswahl sind häufig die folgenden:
- Outsourcing-Erfahrung des Dienstleistungsunternehmens, einschließlich Management-kompetenzen
- Gesamtkosten des Angebots
- Expertise und Branchenerfahrung des Dienstleistungsunternehmens
- professionelle Dienstleistungskompetenz des Anbieters: Serviceorientierung und Supportfähigkeiten
- Flexibilität des Dienstleistungsunternehmens bei den Vertragsverhandlungen und darüber hinaus
- Technologie: Fähigkeit zur Bereitstellung und Instandhaltung von Hard- und Software
- Datensicherheit und ‑schutz
- Referenzen des Dienstleistungsunternehmens
- kultureller „Fit“ der beiden Partner*innen15)Vgl. Cunningham / Fröschl 1995: 155–158.
Ähnlich sollten auch kostenlose externe Dienstleistungen geprüft werden, denn auch diese sollten zumindest über Nutzungsbedingungen oder Service Level Agreements verfügen, die die Rechte und Pflichten der Nutzer*innen und des Dienstleistungsanbieters darlegen. Auch hier kann es bei der Nutzung des Dienstes zu Schnittstellenproblemen kommen, auf die die Forschungseinrichtung reagieren können muss, wenn sie den Dienst in ihren FDM-Servicekatalog aufnimmt.
Nach der Endverhandlung kann der Vertragsabschluss erfolgen. Dieser stellt einen besonders wichtigen Teilschritt des Outsourcing-Prozesses dar, da „ein detaillierter Vertrag eine der entscheidenden Voraussetzungen für ein reibungsloses Funktionieren des Outsourcing ist“16)Wißkirchen 1999: 178.. An dieser Stelle kommt das Vertragsmanagement zum Tragen. In der darauffolgenden Phase der Realisierung sind „die internen Voraussetzungen in Organisation, EDV und Controlling zu schaffen, um einen reibungslosen Übergang der Leistung zu gewährleisten.“17)Wißkirchen 1999: 179–180. Diese Phase erfordert einen nicht zu unterschätzenden Organisationsaufwand und ist „maßgeblich geprägt von Überlegungen zum vorbereitenden Management von auftretenden Schnittstellenproblemen“18)Siebecke 1999: 148.. Hier setzt vor allem das Kommunikationsmanagement an. Hilfreich für diese Phase ist z. B. ein zusammen mit dem Anbieter erarbeiteter Realisierungszeitplan, der beiden Kooperationspartner*innen als Orientierung dienen kann.19)Vgl. Cunningham / Fröschl 1995: 168.
c) Konstituierungs- und Konsolidierungsphase
Die Konstituierungs- und Konsolidierungsphase schließt sich an die erste Umsetzungsphase an. Nun beginnt das Tagesgeschäft, die gemeinsame Arbeit spielt sich nach und nach ein und die Aufgaben des Schnittstellenmanagements sollten langsam in Routine übergehen.20)Vgl. Siebecke 1999: 148. In dieser Phase spielen die Steuerungsmechanismen des Anforderungsmanagements, des Performance-Managements sowie der Serviceverbesserung eine große Rolle.
3. Steuerungsmechanismen des Outsourcing-Prozesses nach Urbach / Würz
Im Folgenden werden die bereits oben genannten sechs Outsourcing-Steuerungsmechanismen nach Urbach und Würz ausführlich beschrieben. Die Steuerungsmechanismen werden erweitert durch eine Reihe von Kontextfaktoren, die die Durchführung eines Outsourcing-Vorhabens entscheidend mitprägen.
a) Anforderungsmanagement
Im Rahmen des Anforderungsmanagements werden die genauen Anforderungen der outsourcenden Forschungseinrichtung bestimmt und mit dem externen Dienstleistungsunternehmen abgestimmt; hier wird zwischen standardisierten und individuellen Anforderungen unterschieden. Urbach und Würz weisen darauf hin, dass die definierten Anforderungen mit der allgemeinen FDM-Strategie der Forschungseinrichtung abgeglichen werden sollten.21)Vgl. Urbach / Würz 2012b: 36–37. Schließlich ist das Outsourcen von Dienstleistungen „eine langfristige, strategische Entscheidung, die von der Unternehmensleitung getroffen werden und Teil einer übergeordneten Vision sein muss.“22)Gross / Bordt / Musmacher 2006: 180. Anforderungsmanagement spielt jedoch nicht nur zu Beginn des Outsourcing-Prozesses eine Rolle. Vielmehr handelt es sich dabei um einen „[k]ontinuierliche[n] Prozess zur Identifikation, Analyse, Priorisierung und Implementierung von quantitativen (z. B. zusätzlicher Server) und qualitativen Änderungen (z. B. neue Serverart, neuer Service, nichtstandardisierter Service)“23)Urbach / Würz 2012a: 242. im erforderlichen Dienstleistungsangebot. Einzelne Teilprozesse / ‑mechanismen des Anforderungsmanagements sind:
- die Pflege eines Servicekatalogs: kontinuierliche Pflege und Ergänzung eines Katalogs der standardisierten Services
- die Anforderungsspezifikation: Entwicklung eines Bestellprozesses für nicht-standardisierte Services, der die Identifikation und Analyse von technischen Anforderungen, die zur Optimierung der Geschäftsprozesse erforderlich sind, beinhaltet
- das Projektmanagement: Bereitstellung von Projektmanagementtechniken und deren Anwendung, um die Umsetzung technischer Änderungen zu steuern.24)Vgl. Urbach / Würz 2012a: 242.
b) Vertragsmanagement
Das Vertragsmanagement befasst sich mit den Bereichen Vertragsverhandlung, Vertragsgestaltung sowie mit „Managementprozesse[n], die sicherstellen, dass vertragliche Verpflichtungen sowohl vom Auftraggebenden als auch vom Auftragnehmenden durchgeführt werden und dass eventuelle Änderungen im Outsourcingvertrag berücksichtigt werden“25)Urbach / Würz 2012a: 242.. Nach Cunningham und Fröschl ist „der Schlüssel zu einem erfolgreichen Vertrag eine klare Definition der erwünschten Geschäfts- bzw. Partnerschaftsbeziehung.“26)Cunningham / Fröschl 1995: 167. Dies sollte bereits Bestandteil des Anforderungskatalogs sein. Siehe dazu Kapitel Planungs- bzw. Umsetzungsphase S. 11. Das bedeutet, dass ein Vertrag ausreichend konkret gestaltet sein sollte, sodass beispielsweise zu beziehende Leistungen im Hinblick auf Lieferumfang, Termine und Preise präzisiert sind.27)Vgl. Gross / Bordt / Musmacher 2006: 181; Herold 1999: 413. Ein zielführender Ansatz in der Vertragsgestaltung ist „die Flexibilisierung des Vertrags […]. Für die praktische Gestaltung des Vertragsmanagements wird empfohlen, dass Organisationen in die transparente Aufbereitung und Kommunikation der Vertragsinhalte investieren.“28)Urbach / Würz 2012b: 37. Eine zentrale Aufgabe des Vertragsmanagements ist daher etwa die Reduzierung bzw. Beherrschbarmachung der Komplexität eines Vertrags. Die wesentlichen Inhalte des Outsourcing-Vertrags setzen sich üblicherweise aus den folgenden Punkten zusammen:
- Ziele der Zusammenarbeit
- Art der Zusammenarbeit bezüglich …
- Festlegung der Vertragsdauer
-
- Definition der Mindestlaufzeit
- Aussagen zu Verlängerungskonditionen (z. B. automatisch um x Jahre)
- Regelungen über vorzeitige Vertragskündigung
- Regelungen über Vertragsbeendigung
- Qualität
-
- Definition und Einigungsbestätigung über Qualitätskriterien
- Rechte und Pflichten bei der Qualitätssicherung
- Garantie- und Serviceregelungen
- geforderte Zertifikate
- Gewährleistung
-
- Festlegen des Umfangs der Gewährleistung entsprechend dem Leistungsumfang und den vereinbarten Zusatzleistungen
- Dauer der Gewährleistungsverpflichtung
- Behandlung von Mängeln bzw. System für Mängelbeseitigung
- Ausschluss der Gewährleistung
- Regelung des Vorgehens bei Haftpflichtfällen
- Auftragsabwicklung
-
- genaue Festlegung von Leistungsumfang und Standards
- genaue Festlegung der Verantwortlichkeiten
- Mitwirkungspflichten der outsourcenden Einrichtung, z. B. Bereitstellung relevanter Informationen über Organisationsstrukturen oder Bereitstellung sachlicher, personeller oder finanzieller Mittel
- Bedarfsgrob- und ‑feinplanung
-
- Festlegen des Verhaltens bei Wegfall oder Neueinführung von Leistungen
- Maßnahmen bei Abweichungen
- Preise
- Zahlungsmodalitäten
-
- Zahlungsfristen
- Anzahlungen
- Rückvergütungen
- Daten- und Informationsaustausch
-
- Definition von Schnittstellen
- Vertraulichkeit
-
- Festlegung des Geltungsbereichs der Vertraulichkeit und der Geheimhaltung
- Datenschutz und Datensicherheit
- Patente und Eigentumsrechte
-
- Festlegung pro Partner*in
- Verwendung von gemeinsam erarbeitetem Know-how
- Übertragungsrechte
- Verhalten im Streitfall
-
- Vertragsstrafen bei unvollständiger, verspäteter oder nicht erbrachter Leistung
- außergerichtliche Schlichtungsansätze
- Benennung einer Schiedsrichter*in
- Gerichtsstand
- Verhalten im Insolvenzfall der Forschungseinrichtung sowie des Dienstleistungsunternehmens
- Katastrophenschutzmaßnahmen29)Die Struktur der Auflistung ist maßgeblich Wißkirchen 1999: 179 entnommen, basiert aber ursprünglich auf Heim 1994: 30. Ergänzungen stammen aus Cunningham / Fröschl 1995: 162; Pracht / Riegl 1999: 256–260; Siebecke 1999: 160.
Urbach und Würz betonen, dass Outsourcing-Verträge „grundsätzlich nicht als gegeben angesehen, sondern während der Laufzeit aktiv den [sich] ändernden Bedingungen angepasst werden“30)Urbach / Würz 2012b: 36–37. sollten. Als Teilmechanismen des Vertragsmanagements definieren sie daher weiterhin:
- die Überwachung und Kommunikation von automatisch stattfindenden Vertragsänderungen (z. B. automatische Preiserhöhung aufgrund von Unterauslastung)
- die Identifikation, Entwicklung und Aushandlung von nicht-automatischen Vertragsänderungen
- das Forderungsmanagement: Prozess zur Identifikation und Überprüfung möglicher Forderungen, zur Entscheidung über die Vorgehensweise und die Durchsetzung von Forderungen31)Vgl. Urbach / Würz 2012a: 242.
c) Kommunikationsmanagement
Das Kommunikationsmanagement „bezieht sich auf die systematische Planung, Implementierung, Überwachung und Weiterentwicklung der Kommunikationskanäle sowohl innerhalb der auslagernden Organisation als auch zwischen der auslagernden Organisation und dem […] Outsourcing-Dienstleister.“32)Urbach / Würz 2012b: 37. Grundsätzlich ist sicherzustellen, dass der Informationsfluss zwischen den Kooperationspartner*innen funktioniert. Welche formellen oder informellen Informationen benötigt das Dienstleistungsunternehmen? Wie wird die Kommunikation im Falle räumlicher Trennung sichergestellt?33)Vgl. Siebecke 1999: 162–163. Eindeutige Absprachen und die deutliche Formulierung von Erwartungen bezüglich des Ablaufs und der Ziele des Outsourcing-Vorhabens sorgen für Transparenz und beugen Missverständnissen und Unzufriedenheiten auf beiden Seiten vor.34)Vgl. Weidt 1999: 241. Ein wichtiger Punkt sind regelmäßige analoge oder virtuelle Arbeitsgespräche. Diese sind „unentbehrlich, um zum einen den persönlichen Kontakt aufrechtzuerhalten, zum anderen aber auch um Informationen auszutauschen, die das Projekt selbst betreffen.“35)Weidt 1999: 241.
Das eigentliche Ziel des Kommunikationsmanagements liegt im Aufbau und der Pflege einer vertrauensvollen Beziehung zwischen den Outsourcingpartner*innen. Ein vertrauensvolles Verhältnis ermöglicht nicht nur schnelles, unkompliziertes Arbeiten, sondern gilt auch ganz prinzipiell als enorm wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.36)Vgl. Urbach / Würz 2012b: 37. Da gegenseitiges Vertrauen unerlässlich ist für ein partnerschaftliches Verhältnis, im Rahmen dessen auch schon mal schnelle und unbürokratische Lösungen gefunden werden können, „sollte nicht am Kommunikationsmanagement gespart werden“37)Urbach / Würz 2012b: 38.. Ein effizientes Kommunikationsmanagement ist gerade auch wichtig, wenn sich Anforderungen und Vereinbarungen im Laufe der Zusammenarbeit ändern.38)Vgl. Cunningham / Fröschl 1995: 170. Dieser Umstand weist auf die kontinuierliche Natur dieses Steuerungsprozesses hin. Insgesamt können unter Kommunikationsmanagement die folgenden Steuerungsmechanismen gefasst werden:
- das Gremienmanagement: Organisation von vertraglich vereinbarten Gremien, Zuordnung von Mitgliedern und Weiterentwicklung der Gremienstrukturen
- das Management der internen Kommunikation: Vermittlung der Veränderungen in den internen Prozessen in der outsourcenden Organisation sowie Abgleichen der internen Kommunikation mit der Kommunikation des Dienstleistungsunternehmens
- das Eskalationsmanagement: Koordination der bei der Eskalation anzuwendenden Kommunikationsprozesse und Strukturen (z. B. Gremium für dringliche Entscheidungen)
- das Problemmanagement: Implementierung und Koordination einer gemeinsamen (Auftraggeber- und Auftragnehmer-) Prozedur zur Lösung von nicht operativen Problemen.39)Vgl. Urbach / Würz 2012b: 242.
d) Risikomanagement
Der Steuerungsmechanismus des Risikomanagements besteht in „Identifikation, Kommunikation, Controlling und Mitigation40)Juristischer Ausdruck für Schadensminderung.“41)Vgl. Urbach / Würz 2012a: 242. von Outsourcing-Risiken. Hierbei unterscheiden Urbach und Würz vier verschiedene Risikoarten, nämlich „strategische, operative, rechtliche und vertragliche Risiken.“42)Urbach / Würz 2012b: 38. Tatsächlich ist eine Aufgabe des Risikomanagements, die anderen Steuerungsmechanismen des Outsourcing-Vorhabens zu kontrollieren und auf etwaige Risiken und Unwägbarkeiten abzuklopfen.43)Vgl. Urbach / Würz 2012b: 38. Der Mechanismus des Risikomanagements kommt daher nicht nur in der Entscheidungs- sowie der Planungs- bzw. Umsetzungsphase zum Tragen, sondern spielt auch in der Konstituierungs- und Konsolidierungsphase eine Rolle. Hier gilt es, Risiken zu „identifizieren, [zu] bewerten, geeignete Maßnahmen zur Risikominimierung [zu] definieren und deren Umsetzung [zu] verfolgen.“44)Gross / Bordt / Musmacher 2006: 178. Typische Risiken im Laufe der Planungs- bzw. Umsetzungsphase liegen im Bereich der Anbieterauswahl und der Vertragsgestaltung; beispielsweise kann eine ungleiche Erfahrungsbasis der beiden Kooperationspartner*innen ein Risiko darstellen. Ein weiteres Risiko ist, wie bereits weiter oben geschildert, die Unterschätzung des Aufwands bei der Startbetreuung des Outsourcing-Projekts. In der Konsolidierungsphase können Risiken darin bestehen, dass Markttrends vom Dienstleistungsunternehmen nicht erkannt bzw. nicht umgesetzt werden und dass die Forschungseinrichtung versäumt, Steuerungskompetenzen weiterzuentwickeln.45)Vgl. Gross / Bordt / Musmacher 2006: 178. Laut Gross, Bordt und Musmacher besteht ein implementiertes Risikomanagement aus drei Hauptelementen:
- dem Risk Assessment, im Rahmen dessen Risiken identifiziert, analysiert und einem Priorisierungsprozess unterzogen werden;
- dem Risk Containment, das dazu dient, Risiken einzugrenzen, indem Aktionen zur Problemlösung geplant und durchgeführt werden;
- dem Risk Monitoring, welches sich damit beschäftigt, „Risiken aufzuzeichnen, zu kontrollieren und neu zu bewerten“46)Gross / Bordt u. a. 2006: 178–179.;
Wichtig ist die gewissenhafte Führung eines Berichtswesens, innerhalb dessen die identifizierten Risiken sowie die eingeleiteten Gegenmaßnahmen dokumentiert werden. Positive wie negative Konsequenzen der Maßnahmen sollten ebenfalls kontinuierlich festgehalten werden.47)Vgl. Gross / Bordt u. a. 2006: 180.
e) Performance-Management
Unter Performance-Management ist der Mechanismus zu verstehen, „der die Überwachung der mit dem Outsourcing verbundenen Ziele effektiv und effizient sicherstellt“48)Urbach / Würz 2012a: 242.. Die Kontrolle der Zusammenarbeit der Outsourcing-Partner*innen im Allgemeinen und der vertragsgerechten Leistungserbringung des Dienstleistungsunternehmens im Speziellen sind wichtige Aufgaben während der Konstituierungs- und Konsolidierungsphase eines Outsourcing-Vorhabens.49)Vgl. Siebecke 1999: 148; Wißkirchen 1999: 180. Um die erbrachten Leistungen transparent zu machen, müssen entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden. Laut Frank Wißkirchen ist das Leistungscontrolling „der Schlüssel für eine effiziente Partnerschaft mit externen Dienstleistern.“50)Wißkirchen 1999: 181. Grundsätzlich sollte sich die regelmäßige Kontrolle der erbrachten Leistungen „an ganz objektiven Kriterien wie Pünktlichkeit, Umsetzungsdauer oder Informations- und Berichtswesen“51)Weidt 1999: 241. orientieren. Daten, die für die Messung der Leistungserbringung vertraglich vereinbart worden sind, müssen gesammelt, analysiert und verifiziert werden.52)Vgl. Cunningham / Fröschl 1995: 170. Gross, Bordt und Musmacher empfehlen die Durchführung regelmäßiger Audit-Verfahren durch externe oder interne Sachverständige anhand von Checklisten, um Qualitätsdefizite aufzuspüren.53)Vgl. Gross / Bordt / Musmacher 2006: 177. In der Aufstellung von Urbach und Würz zum Performance-Management wird zwischen den folgenden Punkten unterschieden:
- Service Level-Management: Hiermit ist der Prozess zur Klarstellung von vertraglich vereinbarten Service Levels, zur Überwachung von Service-Level-Vereinbarungen und zur Kommunikation von Zielerreichungen gemeint.
- Kapazitätsmanagement, im Rahmen dessen die Anzahl der tatsächlich bereitgestellten Dienstleistungen geprüft wird und ggf. Anpassungen gemacht werden.
- Rechnungsprüfung, welche die Überprüfung der vom Dienstleistungsunternehmen gestellten Rechnungen beinhaltet.54)Vgl. Urbach / Würz 2012a: 242.
Eine Herangehensweise an die Messung der erbrachten Performance bzw. der Dienstleistungsqualität, die sich im FDM-Bereich sehr gut eignet, ist das Abschließen von Service Level Agreements (SLA). Diese können z. B. in einen Vertrag integriert werden. Bei SLA handelt es sich um „Vereinbarungen eines Dienstleistungsanbieters mit seinem Kunden bezüglich der zu gewährleistenden Servicequalität.“55)Burr / Stephan 2019: 234. Der entscheidende Vorteil solcher Vereinbarungen ist, dass sie Dienstleistungsqualität mithilfe ausgewählter, objektiv messbarer Daten beurteilbar machen. Im Einzelnen stellt es sich wie folgt dar: Zu Beginn der Kooperation vereinbaren die Outsourcing-Partner*innen „möglichst objektiv messbare Kennzahlen für einzelne Qualitätsparameter, die in der Summe die Servicequalität beschreiben.“56)Burr / Stephan 2019: 234. Auf der einen Seite dient das gemeinsam beschlossene SLA dem Dienstleistungsunternehmen als Orientierungsrahmen und als Mittel, die erbrachte Dienstleistungsqualität zu belegen. Auf der anderen Seite kann eine Forschungseinrichtung anhand eines SLA überprüfen, ob die Leistung in der Qualität und Menge vom Dienstleistungsunternehmen erbracht wurde, in der sie vertraglich vereinbart war. Der Zweck derartiger SLA ist also „in letzter Konsequenz, Dienstleistungsqualität zu normieren und zu garantieren.“57)Burr / Stephan 2019: 234.
Gemeinhin lassen sich drei Arten von SLA unterscheiden, auch wenn diese in der Realität oft nicht genau voneinander abgrenzbar sind: inputorientierte SLA, verrichtungs- und prozessorientierte SLA und outputorientierte SLA.58)Vgl. Burr / Stephan 2019: 235. Inputorientierte SLA legen bestimmte Inputfaktoren fest, wie z. B. die Qualifikation des mit der Dienstleistung betrauten Personals, und standardisieren diese.59)Vgl. Burr / Stephan 2019: 235. Im Rahmen von verrichtungs- und prozessorientierten SLA werden etwa Vereinbarungen zur Erbringung von Dienstleistungen innerhalb bestimmter Zeitfenster oder Vereinbarungen zu Reaktionszeiten bei Supportanfragen getroffen.60)Vgl. Burr / Stephan 2019: 235–236. Im Gegensatz dazu fixieren outputorientierte SLA „Erwartungen des Kunden hinsichtlich der Ergebnisse der Dienstleistungserbringung“61)Burr / Stephan 2019: 236., z. B. die garantierte Verfügbarkeit eines IT-Systems zu einem bestimmten Prozentsatz.
Eine Zusammenstellung wesentlicher Inhalte von SLA liefern Wolfgang Burr und Michael Stephan. Demnach ist die Nennung folgender Punkte in einer SLA essenziell:
- „Vertragsparteien, zwischen denen die Vereinbarung geschlossen wird;
- Beschreibung der zu erbringenden Dienstleistung und der Ziele, die mit der Erbringung der Dienstleistung erreicht werden sollen;
- Rollen, Leistungsbeiträge und Verantwortlichkeiten der Vertragsparteien;
- Festlegung der Kennzahlen zur Beurteilung der Dienstleistungsqualität;
- vordefinierte Prozedur zur Schlichtung von Meinungsunterschieden zwischen den Vertragsparteien;
- Einrichtung eines Mess- und Kontrollsystems, um die Erreichung und Einhaltung von Service-Levels zu verifizieren.“62)Burr / Stephan 2019: 235. Die Autoren orientieren sich hier an Berger 1997; Herman 1998; Metzler 1997.
Burr und Stephan weisen darauf hin, dass weiche, subjektiv interpretierbare Qualitätsdimensionen schwer zu messen sind und daher im Rahmen von SLA keine Berücksichtigung finden. Darunter fallen Aspekte wie die Freundlichkeit der Arbeitskräfte, die vertrauensvolle Arbeitsbeziehung zwischen den Beteiligten und das Entgegenkommen des Dienstleistungserbringers im Konfliktfall.63)Vgl. Burr / Stephan 2019: 237–238. Für den Anwendungsfall des Outsourcings im Bereich FDM überwiegt jedoch der Vorteil, dass die Performance bzw. die Dienstleistungsqualität des externen Dienstleistungsunternehmens präzise gemessen und somit gewährleistet werden kann. Ein weiteres Einsatzfeld von SLA im FDM-Bereich ist die Strukturierung des Dienstleistungsportfolios einer Einrichtung. So können mithilfe von SLA „Dienstleistungen mit unterschiedlich hohen Service Levels als Basisservices, gehobene Services und Premiumservices ausdifferenziert werden“64)Burr / Stephan 2019: 237.. Das Dienstleistungsportfolio des Unternehmens wird auf diese Weise für Kund*innen eindeutig sichtbar und somit besser verständlich.
f) Serviceverbesserung
Der Steuerungsprozess der Serviceverbesserung bezieht sich zum einen auf die stetige Verbesserung der Outsourcing-Steuerungsmechanismen selbst.65)Vgl. Urbach / Würz 2012b: 38. Zum anderen ist die Serviceverbesserung ein „[k]ontinuierlicher Prozess zur Identifikation, Analyse und Umsetzung von Verbesserungspotenzial in Bezug auf die vom Dienstleister bereitgestellten Services“66)Urbach / Würz 2012a: 242.. Als Teilprozesse dieses Steuerungsmechanismus können die beiden folgenden Elemente definiert werden:
- Benchmarking: Preise und Service Level des Dienstleistungsunternehmens sollten regelmäßig mit Konkurrenzunternehmen verglichen und ggf. Preisanpassungen vorgenommen werden; dieses Verfahren muss im Vertrag geregelt sein.
- Umsetzung von Verbesserungen: Die gewonnenen Erkenntnisse müssen in Form von Änderungen in die Praxis überführt werden.67)Vgl. Urbach / Würz 2012a: 242.
Zur erfolgreichen Durchführung eines Outsourcing-Vorhabens gehört also auch die kontinuierliche Analyse des relevanten Unternehmensumfelds: „Umwelt- und Marktbeobachtungen [sind] zwingend erforderlich“68)Siebecke 1999: 149.. Die Bedarfe der Forschenden sollten stets im Auge behalten und als Anforderungen an das Dienstleistungsunternehmen weitergeleitet werden.69)Vgl. Siebecke 1999: 149. Stellt sich mit der Zeit heraus, dass die Outsourcing-Ziele nicht erreicht werden, müssen Steuerungseingriffe vorgenommen werden. So sollten idealerweise „[ü]ber die gesamte Vertragsdauer hinweg, vor allem aber zum Zeitpunkt der Vertragserneuerung […] Verhandlungen und Diskussionen über das Serviceniveau, die Preise und andere Schlüsselaspekte des Vertrages auf der Tagesordnung“70)Cunningham / Fröschl 1995: 170. stehen. Eine Voraussetzung für das Stattfinden solcher Gespräche ist, dass diese bereits im Vorfeld im Rahmen des Vertrags vorgesehen werden.71)Vgl. Cunningham / Fröschl 1995: 170. Finden sich auf dem FDM-Dienstleistungsmarkt deutlich bessere Angebote und kann das ausgewählte Dienstleistungsunternehmen langfristig nicht mit der Konkurrenz mithalten, ist unter Umständen ein Wechsel des Serviceanbietenden vorzunehmen.72)Vgl. Siebecke 1999: 149.
g) Kontextuelle Einflüsse auf die Steuerungsmechanismen
Urbach und Würz betonen, dass die Übertragung von „Best Practices“ beim Outsourcing von einem Unternehmen zum anderen sich schwierig gestaltet, da häufig strategische Hintergründe für die Entscheidung zum Fremdbezug von Dienstleistungen sowie weitere Kontextfaktoren variieren. Die Autoren geben daher eine Reihe von Punkten an, die bei der Implementierung der vorgestellten Steuerungsmechanismen mit einbezogen werden sollten, da sie einen starken Einfluss auf die jeweilige Ausgangssituation ausüben.73)Vgl. Urbach / Würz 2012b: 39. Zu diesen Kontextfaktoren gehören im Fall von FDM-Dienstleistungs-Outsourcing:
- die übergeordnete FDM-Strategie bzw. die Ziele des Outsourcing-Vorhabens
- die betroffenen Geschäftsprozesse (Bedeutung, Veränderungsgeschwindigkeit und Standardisierungsgrad)
- die fremdbezogene Technologie (Wartungsanforderungen, Veränderungsgeschwindigkeit und Standardisierungsgrad)
- rechtliche Anforderungen (z. B. Datenschutzrichtlinien)
- der Outsourcing-Vertrag (Art der Dienstleistung, Abrechnungsmodus und Qualität des Vertrags)
- Beziehungsfaktoren (Vertrauen, räumliche Nähe und Zahl der verfügbaren Anbieter)74)Vgl. Urbach / Würz 2012b: 39; Urbach / Würz 2012a: 243.
Indem die genannten kontextuellen Einflussfaktoren bei der Planung des Outsourcing-Vorhabens berücksichtigt werden, „lassen sich die vorgestellten Steuerungsmechanismen optimal auf die individuellen Rahmenbedingungen und Bedürfnisse der auslagernden Organisation abstimmen.“75)Urbach / Würz 2012b: 39–40.
Anmerkungen
| ↑1 | Bieger 2000: 168. |
|---|---|
| ↑2 | Siebecke 1999: 144. |
| ↑3 | Urbach / Würz 2012b: 35. |
| ↑4 | Vgl. Urbach / Würz 2012b: 36. |
| ↑5 | Urbach / Würz 2012b: 36. |
| ↑6 | Vgl. Urbach / Würz 2012b; Urbach / Würz 2012a. Das Rahmenwerk basiert laut Urbach und Würz auf Erkenntnissen der Forschung im Bereich der IT-Outsourcing-Steuerung und wurde mithilfe von Interviews mit Fachleuten sowie einer praktischen Fallstudie evaluiert und weiterentwickelt. |
| ↑7 | Vgl. Siebecke 1999: 144. |
| ↑8 | Vgl. Cunningham / Fröschl 1995: 135–180. |
| ↑9 | Vgl. Siebecke 1999: 146. |
| ↑10 | Ziegele 2001: 10. |
| ↑11 | Vgl. Cunningham / Fröschl 1995: 141–143. |
| ↑12 | Vgl. Cunningham / Fröschl 1995: 146. |
| ↑13 | Gross / Bordt / Musmacher 2006: 177. |
| ↑14 | Vgl. Wißkirchen 1999: 176; Cunningham / Fröschl 1995: 147. |
| ↑15 | Vgl. Cunningham / Fröschl 1995: 155–158. |
| ↑16 | Wißkirchen 1999: 178. |
| ↑17 | Wißkirchen 1999: 179–180. |
| ↑18 | Siebecke 1999: 148. |
| ↑19 | Vgl. Cunningham / Fröschl 1995: 168. |
| ↑20 | Vgl. Siebecke 1999: 148. |
| ↑21 | Vgl. Urbach / Würz 2012b: 36–37. |
| ↑22 | Gross / Bordt / Musmacher 2006: 180. |
| ↑23, ↑48, ↑66 | Urbach / Würz 2012a: 242. |
| ↑24, ↑67 | Vgl. Urbach / Würz 2012a: 242. |
| ↑25 | Urbach / Würz 2012a: 242. |
| ↑26 | Cunningham / Fröschl 1995: 167. Dies sollte bereits Bestandteil des Anforderungskatalogs sein. Siehe dazu Kapitel Planungs- bzw. Umsetzungsphase S. 11. |
| ↑27 | Vgl. Gross / Bordt / Musmacher 2006: 181; Herold 1999: 413. |
| ↑28, ↑32 | Urbach / Würz 2012b: 37. |
| ↑29 | Die Struktur der Auflistung ist maßgeblich Wißkirchen 1999: 179 entnommen, basiert aber ursprünglich auf Heim 1994: 30. Ergänzungen stammen aus Cunningham / Fröschl 1995: 162; Pracht / Riegl 1999: 256–260; Siebecke 1999: 160. |
| ↑30 | Urbach / Würz 2012b: 36–37. |
| ↑31, ↑41, ↑54 | Vgl. Urbach / Würz 2012a: 242. |
| ↑33 | Vgl. Siebecke 1999: 162–163. |
| ↑34 | Vgl. Weidt 1999: 241. |
| ↑35 | Weidt 1999: 241. |
| ↑36 | Vgl. Urbach / Würz 2012b: 37. |
| ↑37, ↑42 | Urbach / Würz 2012b: 38. |
| ↑38, ↑52, ↑71 | Vgl. Cunningham / Fröschl 1995: 170. |
| ↑39 | Vgl. Urbach / Würz 2012b: 242. |
| ↑40 | Juristischer Ausdruck für Schadensminderung. |
| ↑43 | Vgl. Urbach / Würz 2012b: 38. |
| ↑44 | Gross / Bordt / Musmacher 2006: 178. |
| ↑45 | Vgl. Gross / Bordt / Musmacher 2006: 178. |
| ↑46 | Gross / Bordt u. a. 2006: 178–179. |
| ↑47 | Vgl. Gross / Bordt u. a. 2006: 180. |
| ↑49 | Vgl. Siebecke 1999: 148; Wißkirchen 1999: 180. |
| ↑50 | Wißkirchen 1999: 181. |
| ↑51 | Weidt 1999: 241. |
| ↑53 | Vgl. Gross / Bordt / Musmacher 2006: 177. |
| ↑55, ↑56, ↑57 | Burr / Stephan 2019: 234. |
| ↑58, ↑59 | Vgl. Burr / Stephan 2019: 235. |
| ↑60 | Vgl. Burr / Stephan 2019: 235–236. |
| ↑61 | Burr / Stephan 2019: 236. |
| ↑62 | Burr / Stephan 2019: 235. Die Autoren orientieren sich hier an Berger 1997; Herman 1998; Metzler 1997. |
| ↑63 | Vgl. Burr / Stephan 2019: 237–238. |
| ↑64 | Burr / Stephan 2019: 237. |
| ↑65 | Vgl. Urbach / Würz 2012b: 38. |
| ↑68 | Siebecke 1999: 149. |
| ↑69, ↑72 | Vgl. Siebecke 1999: 149. |
| ↑70 | Cunningham / Fröschl 1995: 170. |
| ↑73 | Vgl. Urbach / Würz 2012b: 39. |
| ↑74 | Vgl. Urbach / Würz 2012b: 39; Urbach / Würz 2012a: 243. |
| ↑75 | Urbach / Würz 2012b: 39–40. |